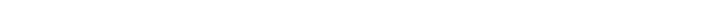Einmal über den Ural und zurück
Eigentlich habe ich meine festen Grundsätze, wenn ich auf einen meiner gnadenlos eng getakteten Reisen gehe: Flugplatz nicht vor zehn, Autobahn nicht nach zwei, Jetlag überhaupt nicht, stattdessen ein Paket Schwarzbrot im Koffer – gegen das Heimweh und für die Kraft in der kleinen Oktave. Es sind nur wenige Regeln, denen ich mich freiwillig unterwerfe, aber sie sind mir heilig, ein notwendiger Luxus sozusagen, der mir garantiert, dass ich auch nach langen Fahrten und einem Arbeitspensum von bis zu drei Konzerten pro Tag jederzeit einsatzfähig bleibe. Aber nun habe ich sie alle auf einmal mit Füßen getreten, meine liebgewordenen Wegbegleiter – und das ausgerechnet zu einer Jahreszeit, in der alle Welt seine guten Vorsätze hätschelt und ich alljährlich von einer Woche Urlaub am Strand träume, den ich aber tatsächlich nie antrete, weil sich irgendwie immer etwas interessanteres ergibt.
Schuld an allem ist genau genommen das Rathaus von Kazan, das mir mit seiner Fassade im Stil der Neorenaissance sogleich gefallen hat, als ich auf die Schnelle über Google Images ergründen wollte, woher die Einladung kam, die mich und meinen Duo-Partner Aivars Kalejs mitten im Januar dorthin bringen sollte, wo der Ural Europa von Asien trennt.
Kazan, das klang verheißungsvoll nach Tausendundeiner Nacht und Tatarstan, die dazugehörige Republik, die kannte irgendwie niemand wirklich, außer dem Team der Deutschen Botschaft in Riga, denn das kennt schon von Amts wegen alles und konnte mir sofort erzählen, dass Tatarstan eine der autonomen Republiken in der russischen Föderation ist, die bei nur knapp vier Millionen Einwohnern 1700 Bibliotheken, 30 Hochschulen, 90 Museen und 12 professionelle Theater betreibt – ein Land der Superlative für jemanden, der wie ich zur Gattung der Kopffüßler zählt. Ich beschloss also, meinen Widerwillen gegen mehrfache Zeitzonensprünge und Schichtarbeit ausnahmsweise einmal zu verdrängen und mir diese wundersame Welt aus der Nähe anzusehen.
Neben dem Konzert in Kazan sollte es ein weiteres geben im neugebauten Opernhaus von Joschkar Ola, der Hauptstadt der Nachbarrepublik Mari El, und eh ich mich versah, waren wir auch noch in Jekaterinburg und in Tscheliabinsk auf der asiatischen Seite des Urals zur Einweihung von zwei Konzertsälen verabredet. Der Zeitplan war eng, weil alle vier Veranstaltungen in der zweiten Wochenhälfte stattfinden sollten und zusätzlich auf der Halbzeit der Ural überwunden werden musste. Aber ich war voller Zuversicht, dass alles gut zu schaffen sein würde, weil keins der Konzerte – bedingt durch die Zeitverschiebung von bis zu vier Stunden – am Abend begann und mein Flieger ganz gemütlich mittags von meiner Zweitheimat Berlin aus startete, wo ich vorher noch einmal in aller Ruhe im eigenen Bett ausschlafen konnte.
Zwei Pelze, eine Kuscheldecke, Reifröcke und Notenmappen
An einem Montag Ende Januar setze ich mich also gemeinsam mit einem beeindruckenden Gepäck – bestehend aus zwei alten Pelzen, die ich übereinander ziehen will (denn der Wetterbericht hat mir von Minusgraden bis zu 35 erzählt), einer Kuscheldecke (zum Schutz vor nächtlichen Kälteattacken auf mein golfstromverwöhntes Instrument), meinen Reifröcken (getreu dem Motto: das Kleid ehrt den Gastgeber) und meinen Notenmappen (in denen mir die Texte der russischen Lieder, die ich singen will, die Zeit bis Moskau vertreiben sollen) – in mein Auto, in dem mich am nächsten Vormittag meine Familie nach Schönefeld bringt, wo mein Flugzeug – natürlich eine Aeroflot Maschine – Richtung Moskau startet, weil ich von dort aus dann gemeinsam mit meinem Kollegen aus Riga nach Kazan weiterfliegen werde. Endlose Schlangen – doppelte Sicherheitkontrollen, Check in, Passkontrolle – immer inmitten von ferienfröhlich gekleideten Leuten, die alle über Moskau in die Südsee unterwegs sind und die es für einen guten Witz halten, bei meinem Anblick „Det jeht wohl ab nach Sibirien, wa?“, zu orakeln, ohne zu ahnen, wie nah sie damit der Wahrheit kommen.
In Moskau fühle ich mich sonderbar heimisch auf dem riesigen Flugplatz und das liegt nicht nur daran, dass ich weiß, wo meine Lieblings–Kaffeehaus-Kette Ihre Filiale hat, und dass ich sie sofort ansteuern kann, weil ich nämlich ein gutes Dutzend Tausend-Rubel-Scheine in der Tasche habe vom letzten Konzert in dieser schönen, aber teuren Stadt, in der man – nach meiner Erfahrung – mit Devisen und Keditkarten nicht reibungsloser vorankommt als anderswo auf der Welt.
Es liegt vor allem an der herzlichen Hilfsbereitschaft, mit der man mir auch diesmal wieder begegnet, obwohl doch mein Repertoire an russischen Vokabeln kaum über das hinausgeht, was man mitnimmt, wenn man eine Tolstoi-Literaturverfilmung im deutschen Fernsehen anschaut, und obwohl im Gegenzug wahrlich nicht jeder Russe englisch spricht. Überall in Moskau habe ich Leute getroffen, die die eigene U-Bahn abfahren lassen, um mich in den richtigen Zug zu setzen, die mir eine Fahrkarte schenken, wenn meine Kreditkarte nicht akzeptiert wird und mir zum Abschied auch noch ihre Visitenkarte dalassen, damit ich mich „in any case of emergency“ bei ihnen melden kann. Und so sitze ich gemütlich unter roten Laternen in einem weichen Sessel bei „Schokoladnidza“ und genieße die Fürsorglichkeit der Kellnerin, die mich zwischen Capuccino und frischen Salaten unaufgefordert mit heißem Zitronenwasser versorgt und mir erklärt, dass ich niemals „gerädschje voda“ bestellen soll, sondern stets „kipitok“, wenn ich sicher sein will, dass mein Tasseninhalt Trinkwasserqualität hat.
Nach drei Stunden kommt Aivars, mein Kollege aus Riga, nach drei weiteren hebt unsere Maschine ab in Richtung Kazan. Inzwischen meldet die Zeittafel 23.30 Uhr, aber das Flugzeug ist trotz der späten Stunde bis auf den letzten Platz besetzt. Müde Gesichter bei den Passagieren, müdere bei den Stewardessen, denen das standardisierte Schön-dass-Du-da-bist-Lächeln auf sonderbar starre Weise ins Gesicht gefroren ist. In Russland gibt es kein Nachtflugverbot – hier, wo die Entfernungen so groß sind, dass man den Flieger benutzt wie andernorts den Bus, wird im 24 Stunden Takt gearbeitet, und als wir schließlich gegen 2 Uhr morgens in der Hauptstadt von Tatarstan landen, erzählt mir die Crew, dass es für sie noch einmal non stop zurück nach Moskau geht.
Und auch für uns ist der Tag noch lange nicht zu Ende. In der Halle erwartet uns Dimitrij, der uns mit dem Auto ins Hotel bringen soll. Angeregt unterhält er sich mit Aivars, der wie viele Letten aus Riga russisch spricht als wäre es seine Muttersprache, weil dort jeder zweite Nachbar Russe ist, während ich eine Tüte mit Zeit- und Stadtplänen durchsuche nach einer sog. „Satellitenkarte“, einer SimKarte fürs Handy, die ich mir bestellt habe, weil man sie in Russland unbedingt braucht, wenn man als Ausländer telefonieren möchte, ohne innerhalb kürzester Zeit ein bettelarmer Mann zu sein. Ich bin so beschäftigt damit, dass ich aus der Tür laufe, ohne mich auf das vorzubereiten, was mich draußen erwartet: eisig fegt der Nachtwind von vorn in mein Gesicht, es ist ein Gefühl, als würden sämtliche Messer von Chatschaturjans Säbeltanz gleichzeitig auf mich losgelassen. Entsetzt drehe ich mich zur Seite, der Schmerz im Gesicht lässt nach, aber ich fühle ein ungutes Spannungsgefühl im linken Auge und gleichzeitig muss ich feststellen, dass die dicken Stiefel, die ich an den Füßen trage und die mich mit ihren Profilsohlen bis jetzt immer zuverlässig durch jeden Winter gebracht haben, völlig überfordert sind von den Straßenverhältnissen hier am äußersten Rand Europas. Schnellstens rette ich mich am Arm unseres Fahrer in das bereitstehende Auto, wir fahren los – und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus: Überall auf der Straße elegante dreiarmige Laternen, die die Autobahn bis in die Stadt hinein in ein sonnenwarmes Licht tauchen, das in merkwürdigem Gegensatz steht zu den Außentemperaturen und den blitzweißen Schneebergen am Straßenrand. Auf halber Strecke ein hell erleuchtetes eisernes „Welcome“, das uns erzählt, dass Kazan sich seit dem Jahr 2000 Unesco-Kulturerbe nennen darf, und gleich darauf liegt die Altstadt vor uns, Prachtbauten auf beiden Seiten der Straße, angestrahlt auch jetzt, mitten in der Nacht. Links in Form einer trutzigen mittelalterlichen Burganlage das „Puppentheater“, das in diesem Teil der Erde zu jedem Stadtbild gehört, rechts der Palast der Landwirte, prächtiger als so manches üppige Barockschloss, vorn der Sitz des Staatspräsidenten von Tatarstan, ionische Säulen überall, langgezogene Kolonnaden, wohin man schaut, und über allem der Kreml, von dem wir allerdings wegen der zu geringen Entfernung nicht viel mehr sehen als die riesige Befestigungsmauer. Säulen auch am Opernhaus und am Konservatorium, die beide im rechten Winkel zueinander am selben Platz stehen, an dem auch unser Hotel liegt.
Marmor, poliertes Holz und Brokat in der Oper von Joschkar Ola
Schnell eingecheckt, es ist entsetzlich früh inzwischen und morgen steht um 11 Uhr (9 Uhr MEZ – o je!) ein Wagen der Staatsoper von Joschkar Ola vor der Tür, um uns nach Mari El zu bringen, der Nachbarrepublik im Nordwesten von Tatarstan, weil dort unser erstes Konzert stattfinden soll. Mein Zimmer ist groß, gemütlich und auch jetzt in der Nacht unglaublich gut geheizt, ohne dass erkennbar wäre, woher die Wärme eigentlich kommt. Schnell ins Bett und schon weckt mich mein Handy – leider eine Stunde zu früh, weil es nicht verstanden hat, wie weit es nach Osten verschleppt wurde, und das deshalb orientierungslos durch die Zeitzonen springt.
In der Halle wartet Alexandra, Pianistin, Russin, zart und schön mit ihrem rotbraunen Pony, den sie dekorativ über den Rand ihrer Nerzkappe gekämmt hat. Sie ist zu unserer Betreuung abgestellt und wird uns von nun an hier in Kazan überallhin begleiten. Auch jetzt ist sie extra gekommen, um uns ins bereitstehende Auto zu setzen und zu schauen, ob alles nach Plan läuft. Mitleidig begutachtet sie mein rotes Auge, ja, sie kennt das, man lernt es hier sehr schnell, dem Wind die kalte Schulter zu zeigen, bedeutet sie mir mit anmutigen Gebärden, denn englisch spricht sie nicht. Ob ich Augentropfen brauche, will sie wissen, nein, alles gut, kein Problem – und ab geht es in Richtung Autobahn. Einfamilienhäuser, verschneite Gärten, auch in diese Richtung dieselbe Idylle wie auf dem Weg vom Flugplatz, und allmählich beginne ich mich zu fragen, wo denn die 1,2 Millionen Menschen wohnen, die hier in Kazan zu Hause sind.
Endlose Wälder rechts und links der Autobahn, Kiefern und Birken soweit das Auge reicht, beinahe so wie bei uns an der See. Die Fahrbahn ist wie überall gut geräumt, der Schnee am Straßenrand blitzsauber, wenn Salz benutzt wird, dann ist es gefroren und verbindet sich mit dem Schnee zu einem trockenen rutschfesten Pulver, nirgendwo Pfützen oder Matsch. Kaum Laster, die – so wie bei uns in harten Wintern – den kältestarren Asphalt zermürben könnten, keine Spurrillen, keine Schlaglöcher, an den Autobahntankstellen moderate Benzinpreise – nach und nach beginne ich zu verstehen, was es bedeutet, in einem Land unterwegs zu sein, in dem Erdgas und Erdöl aus dem Boden quillen. Jevgenieff, unser Fahrer fährt zügig, wir kommen gut voran, bis uns plötzlich ein Polizeifahrzeug entgegenkommt und anhält. Nein, keine Sorge, wir haben nichts falsch gemacht, unser Fahrer soll als Zeuge befragt werden gegen einen allzu eiligen Verkehrsteilnehmer, der uns gerade überholt hat. Es dauert eine Weile, bis Jevgenieff zurückkommt und bis wir weiterfahren dürfen – alle sind einverstanden, bis auf den aufmerksamen Polizeihund, der uns lange laut kläffend auf der Standspur verfolgt, weil er es offensichtlich nicht gewöhnt ist, dass bei einer Geschwindigkeitskontrolle jemand abfahren darf, ohne das Portemonnaie herausgeholt zu haben, und der mich in seinem Verhalten an die schönen und klugen Wachhunde der griechischen Ausgrabungsstätten erinnert, die sich den ganzen Tag lang bereitwillig von jedermann an den Ohren ziehen lassen, bis zu dem Augenblick, da das Museum schließt und sie plötzlich die letzten Gäste sehr unerbittlich zu ihren Autos begleiten und bis zur Hauptstraße bringen, weil nämlich ihr Dienst beginnt.
Joschkar Ola ist bezaubernd. Aus der Ferne über den Wolga-Nebenfluss Kleine Kokschaga hinweg wirkt die Silhouette der Stadt so, als hätte hier jemand mit den Bausteinen einer Edel-Edition von Lego gespielt – rostrot und grün Fassaden und Dächer, alles in den Farben der Erde und des Waldes, dem Mari El einen Teil seines Wohlstandes verdankt. Im Opernhaus empfängt uns der Direktor Konstantin Ivanoff, seines Zeichens Tänzer mit Bilderbuch-Karriere, in seinem Büro und führt uns in sein Gästezimmer, wo wir in üppigen weich und weiß gepolsterten Stilmöbeln einen halben Kaffee trinken, denn die Zeit drängt – das Konzert beginnt wegen der kurzen Tage und der nächtlichen Kälte wie die meisten Veranstaltungen früh – um 18 Uhr soll es losgehen. Eilig beziehe ich meine Garderobe, bestaune das Haus, das – sehr ungewöhnlich für ein Theater – backstage ebenso sorgfältig ausgestattet ist wie im Foyer, bewundere den Marmor der Treppenhäuser, das kostbar polierte Holz der Portale, den feinen Brokat der Portieren, und laufe auf die Bühne, wo mein Kollege bereits am fahrbaren Spieltisch der Operhaus-Orgel sitzt und begonnen hat, sich mit ihren klanglichen Möglichkeiten vertraut zu machen.
Der Saal – Parkett und zwei Ränge – ist ebenso neu wie das ganze Haus und hat mit seiner rotsamtenen Bestuhlung, seinem herrlichen Kronleuchter und seinen vielen stilistischen Zitaten etwas derart altersloses, dass es ihm nur noch an der nötigen Patina fehlt, damit man nicht mehr auf den ersten Blick wird sehen können, wann er tatsächlich erbaut worden ist.
Glanzstück der Staatsoper von Joschkar Ola ist die mächtige Orgel, optisch sehr geschickt integriert in das Gesamtensemble, dem sie einen ganz eigenen Charme verleiht. Am Platz der Königsloge das Hauptwerk mit seinen großen, waagerecht in den Raum ragenden Spanischen Trompeten und einer kleinen Empore mit Spieltisch, die zusätzlich genug Platz für drei bis vier Solisten bietet. Vorn im Saal rechts und links der Bühne anstelle der seitlichen Logen zwei stattliche Rückpositive für den perfekten Stereo-Effekt, der das Publikum akustisch in seine Mitte nimmt.
Oh, wie gern würde ich das ganze Konzert von dort oben singen, denn von der Bühne aus muss meine Stimme die Wellen der Rückpositive durchdringen, die von beiden Seiten zwischen Publikum und mir einen dichten Klangteppich aufbauen, der mich von den Zuhörern trennt. Aber das ist leider aus optischen Gründen völlig undenkbar und so beschließe ich, mir diese Position als Überraschung für den Danse Macabre und die große Choralsonate meines Kollegen aufzubewahren, ein Stück, bei dem ich am Schluss eine der Orgelstimmen als Vokalise übernehme.
Wir sind gut in der Zeit und beschließen um halb fünf, eine Kleinigkeit zu essen, dann bleibt uns danach noch eine halbe Stunde für die beiden Stücke auf der Orgelempore, bevor wir den Saal für den Einlass räumen müssen. Aber es kommt, wie fast immer, alles anders als geplant.
15 Minuten bis zum Konzert – und kein Schlüssel
In der Tür der Theaterkantine steht ein junger Mann, er ist von der Zeitung und hat geduldig gewartet, bis wir mit unserer Probe fertig sind. Nun würde er sich gern mit uns unterhalten und während die Kellnerin unser Essen bringt und ich ihn mit Kuchen von der Theke versorge, erzählt ihm Aivars alles mögliche auf russisch in sein Diktiergerät hinein. Um zehn nach fünf küsst er mir wie ein Kavalier alter Schule mit formvollendeter Verbeugung zum Abschied die Hand – das ist hier, wie mir nach und nach klar werden wird, so üblich – Aivars springt auf die Bühne und ich laufe in meine Garderobe, um ihm einen Schluck Kaffee zu bringen – es bleibt eine Viertelstunde Zeit für eine Viertelstunde Musik.
Und dann überschlagen sich auf putzige Weise die Ereignisse. An meine Garderobentür klopfen zwei Leute mit einer Kamera – sie sind vom Fernsehen und brauchen ein Interview, gern hier direkt vor der Tür zu meinem Zimmer – und zeitgleich stehen zwei weitere Damen im Türrahmen. Die eine ist bewaffnet mit einer riesigen Spraydose nebst klitzekleinen Haarnadeln und die andere trägt ein Bügeleisen in der Hand, zum Zeichen ihrer Zunftzugehörigkeit und um mir zu bedeuten, was sie mit mir vorhaben, denn englisch sprechen sie alle beide so wenig wie ich russisch.
Ich lasse alle stehen und alles liegen, sbassssiba boltschoi, ich bin gleich wieder da, und laufe, meinen Kollegen von der Bühne zu holen. Probe ade, macht nichts. Zu viel proben ist eh ungesund und wir haben die Choralsonate schließlich zuletzt gerade erst vor einem halben Jahr in Moskau gesungen. Alles gut also …… wenn da nicht die Tür zu meiner Garderobe wie von Zauberhand verschlossen wäre. Ich war es nicht, ich weiß es ganz genau, ich habe die Tür mit den vielen Leuten davor offen gelassen, der Schlüssel liegt auf dem Tisch dahinter, ebenso wie mein Konzertkleid, in dem ich in wenigen Minuten auftreten soll, und die Noten, die ich dringend für die Arien von Bach benötige. Die Damen vom Haus schwärmen aus, um den Türschließer zu suchen, und kommen hilflos mit den Achseln zuckend zurück. Mein Lidschlag, der wegen meines Silberblicks auch unter Normalbedingungen eine beeindruckende Frequenz aufweist, erhöht sich auf 90/s, während ich neben meinem Kollegen vor der Kamera stehe und versuche, glücklich auszusehen, etwas Kluges zu sagen und gleichzeitig einen Schlachtplan für den schlimmsten Fall zu entwerfen.
Um 4 Minuten vor 6 kommt endlich jemand mit dem Schlüssel angestürmt, die Dame mit der Dose schiebt mir in aller Eile drei ihrer kleinen Haarnadeln in die Frisur, damit ich auf dem Kopf nicht ganz und gar so aussehe, als hätte ich an Dschingis Khans finalem Galopp auf Samarkand teilgenommen, die andere hilft mir beim Kampf mit den unzähligen Haken und Ösen meines Kleides, und während der Vorhang sich öffnet stehe ich bei Fuß – geschafft! – und der Spaß beginnt.
Wenn man mich fragt, wann ich denn eigentlich Ferien mache, sage ich immer, wenn ich singe, und so ist es auch hier und heute. Vergessen sind der Stress von eben, die viel zu kurze Nacht, das rote Auge und der fehlende Puder auf meiner Nase. Was zählt, sind die fröhlichen Gesichter der Zuhörer und ihre Zustimmung, die uns vom ersten Stück an zeigt, dass sie uns aufgenommen haben in ihre Gemeinschaft, um mit uns zu feiern – aus Liebe zur Musik und aus Freude am Dialog in einer Sprache, die in Zeiten, in denen die Welt nur schwer zu verstehen ist, den Schmerz in Schönheit verwandelt und die Schönheit in Ewigkeit.
Am Ende drei Zugaben, in der Mitte das in diesem Land der Marienverehrung obligatorische Ave Maria, bei dessen Ankündigung die Damen vor Freude aufjauchzen und die bereitgehaltenen Schnupftücher aus der Tasche ziehen. Blumen, Geschenke, Heiligenbilder, die uns beschützen sollen, viele Umarmungen, und dann geht es im Hui zurück nach Kazan, denn morgen soll weitergesungen werden und Jevgenieff, unser Fahrer, muss die weite Strecke, wenn er uns endlich abgeliefert hat, noch einmal zurückfahren.
Trotzdem macht er einen kleinen Umweg, um uns die Stadt zu zeigen. Auf der Landseite sind alle Gebäude weiß, auch Mari El hat ein riesiges Puppentheater, anders als in Kazan im Tudor-Stil, es hat einen Palast für seinen Präsidenten und wundervolle langgezogene Prachtbauten, die an Venedig erinnern und alle hundert Meter durch Tordurchfahrten gegliedert sind, die den Blick auf die dahinterliegenden Gebäude freigeben. Es hat begonnen zu schneien und Joschkar Ola zeigt sich uns durch die Autoscheiben und im Licht unzähliger Scheinwerfer von seiner schönsten Seite, es sieht aus wie die Märchenkulisse eines Schüttelbechers, den man heftig in Bewegung gesetzt hat.
Ein Flügel aus der Zeit von Rachmaninoff und Cognac gegen die Kälte
Am nächsten Morgen wartet pünktlich um 11 Uhr Alexandra im Frühstücksraum unseres Hotels und will uns über den bizarr vereisten Platz ins gegenüberliegende Konservatorium bringen. Es hat inzwischen trotz starker Minusgrade wieder angefangen zu schneien – ganz offensichtlich sind weiter oben am Himmel wärmere Luftschichten unterwegs, deren Feuchtigkeit sich bei Berührung mit dem eisigen Erdboden unter den Füßen der Passanten sofort zu immer spiegelglatteren Gefriergebilden verbindet, gegen die kein Besen je ankommen kann.
Leichtfüßig tänzelt sie vor uns her auf ihren zierlichen Stiefelchen mit den hohen Absätzen und den versteckten Plateausohlen, die auch hier jeder an den Füßen trägt, der schön und chick sein will, und löst damit bei mir die selbe Mischung aus Sorge und Faszination aus, die mich beim Anblick ungesicherter Dachdecker ergreift. Dummerweise missdeutet sie mein Zögern als Angst vor der hügeligen Eisbahn auf der Straße und nimmt mich – sie, die mir gerade einmal bis zum Kinn reicht – kameradschaftlich unter den Arm, ohne zu ahnen, wie gering mein Vertrauen in sie als Stütze im Ernstfall ist. Behutsam rutschen wir also im Passgang über den Platz – am eisernen Lenin vorbei, am Opernhaus vorbei, am Konservatorium entlang auf die Rückseite des Gebäudes zum Eingang für die arbeitende Bevölkerung. Geschafft.
Im Haus erwartet mich die nächste Überraschung – man trägt Sommer im Winter von Tatarstan. Miniröcke, kurze Ärmel, kleine Kleidchen mit großem Dekolleté und zarte Seidenstrümpfe überall, auch Alexandra trägt unter ihrem Pelz nur ein kurzärmeliges Oberteil. Was bei uns völlig undenkbar wäre, ist hier völlig normal, der Winter dauert einfach zu lange, als dass man ihn in Jeans und Pullover verbringen will – und deshalb wird ordentlich geheizt, 22 Grad sind gerade richtig passend und auch bei 23 wird noch niemand böse.
In seinem Büro begrüßt uns Prof. Rubin Abdullin, Rektor des Hauses seit 1990 und seines Zeichens selbst Organist. Freundlich erkundigt er sich nach Aivars Befinden, den er von Konzertreisen nach Riga kennt, nach unserem Eindruck von Joschkar Ola und von der Opernhaus-Orgel, die nämlich unter seiner Egide gebaut worden ist. Mein Blick fällt auf einen reich verzierten weißen Flügel – ja, das ist ein ganz besonderes historisches Instrument, Rachmaninoff höchstpersönlich hat es im Jahre 1912 mit einem Konzert eingeweiht. Das Portrait des Komponisten – aufgenommen bei diesem Anlass – hängt darüber, wir machen schnell ein Foto zur Erinnerung und dann bringt uns Prof. Abdullin in den Großen Saal des Konservatoriums, der seinen Beinamen in jeder Hinsicht zu recht trägt, sowohl, was die Anzahl der Plätze anbelangt, als auch, was die Maße der Orgel betrifft.
Er zeigt mir den Platz, wo man als Sänger am besten zu hören ist, oben direkt vor der Orgel, möchte etwas Vorgesungenes und zieht sich in die Tiefen das Saals zurück. Ich singe eine Arie von Bach, den Anfang von oben, dann wandere ich zum Vergleich vorn an die Rampe, scheinbar um ihm entgegen zu gehen, tatsächlich aber, weil ich sehen will, ob von da der Kontakt zum Publikum vielleicht doch besser ist als von hinten oben. Und nun zeigt sich, dass Rubin Abdullin ein Mann von schnellem Verstand und großer Herzenswärme ist.
Strahlend kommt er mir entgegen, küsst mir mehrfach kräftig die Hände, freut sich auf den Abend und sagt: “Stehen Sie, wo Sie wollen, es klingt bei Ihnen überall gleich, nur bedenken Sie, dass auf der Empore fast doppelt so viele Leute sitzen werden wie im Parkett und vergessen Sie deshalb nicht, auch denen von Zeit zu Zeit ein Lächeln zu schenken.“ Und damit geht er wieder an die Arbeit und wir tun das Gleiche.
Nach zwei Stunden kommt Alexandra, um uns zur Pause in die Kantine zu begleiten. Ich versuche, sie zum Essen einzuladen, aber sie nimmt nur einen Tee, den man hier in großen bauchigen Kannen serviert und den man lange abkühlen lässt, weil er die von der Kälte gestressten Blutgefäße nicht zusätzlich belasten soll, so vermute ich, denn auch das Essen wird grundsätzlich lauwarm serviert. Alexandra wird nicht die einzige bleiben, die in unserer Gegenwart niemals etwas anderes zu sich nimmt als allerhöchstens ein ganz kleines Stückchen Schokolade. Eiserne Disziplin bei Tisch und ein gnadenlos durchkalkulierter Speiseplan gehören hier ganz offensichtlich zum Überlebenskonzept – ich jedenfalls sehe so gut wie niemanden, dem die Figur auch nur ansatzweise aus dem Ruder gelaufen wäre bei dieser Nation von Eiskunstläufern, für die sich Diäten wahrscheinlich schon wegen des beharrlichen Dauerfrostes von selbst verbieten.
Schnell ein kleiner Salat und dann geht es zurück in den Saal, denn die Zeit drängt. Proben für ein Konzert mit einer großen Orgel, so wie hier in Kazan, sind überhaupt nicht schnell gemacht, zu zahlreich sind die klanglichen Möglichkeiten, die sich durch die Kombination der unterschiedlichen Stimmen ergibt. Alles kann man verändern, das Fundament, den Mittelbau, die Gamben, die Flöten, die Klarinetten, bis man schließlich etwas wirklich gutes gefunden hat. Es ist beinahe so, als ob man sich für jedes Stück das passende Orchester zusammenstellt. Schau mal, sagt mein Kollege, was hältst Du von diesen Flöten für den Händel – oder willst du es vielleicht doch lieber so? und er mischt noch ein wenig Holz bei und lässt den Vierfuß weg. Ja, das zweite gefällt mir besser, es ist wärmer und deshalb singe ich das Stück heute also mal nicht wie eine Lerche, sondern wie eine Nachtigall.
Beim Konzert habe ich ein merkwürdiges Aha-Erlebnis, das sich auch auf der anderen Seite des Ural noch einmal wiederholen soll. Normalerweise reagiert jedes Publikum, auch wenn es das selbe Programm hört, zumindest hier und da individuell. Es gibt Zuhörer, die blockweise klatschen, es gibt andere, die – weil in der Kirche – gar nicht klatschen, solche, die immer klatschen oder aber auch solche, die den Wunsch haben, sich nach jedem Stück zu äußern, noch bevor der letzte Ton gesungen ist. Besonders spannend ist es mit denen, die zunächst keine Reaktion zeigen und irgendwann, wenn ich mich daran gewöhnt habe, ihre Dauerstarre als Zeichen der Zustimmung zu nehmen, und mich meinerseits in die innere Emigration zurückgezogen habe, nach einem Stück, das ihnen besonders gut gefällt, aufspringen und mich völlig aus dem Konzept bringen, weil sie plötzlich lauter sind als alle anderen zusammen. Ich habe viel erlebt im Austausch mit dem Publikum, aber dass mehr als zweitausend Menschen, für die wir am Ende unserer Reise Musik gemacht haben werden und die hunderte von Kilometern voneinander entfernt zu Hause sind, alle so derart gleich reagieren, dass man glauben könnte, es seien immer wieder die selben, die im Saal sitzen, das ist mir nirgendwoanders begegnet als hier.
Bei jung und alt dieselbe konzentrierte Hingabe an die Musik, dieselbe hellwache Versunkenheit, die jedes Mal, wenn das Nachspiel das Ende eines Stückes ankündigt, in Vorfreude übergeht, darauf, uns sagen zu können, dass es ihnen gefällt, was wir alles mitgebracht haben für sie. Und auch das, was ihnen ganz besonders gut gefällt, unterscheidet sich nicht, ganz gleich, ob wir auf der einen oder der anderen Seite der großen Berge unterwegs sind. Überall die gleiche Bitte um immer neue Zugaben, überall die gleiche Freude am Überraschungs-Ave-Maria – ich bin so froh und dankbar, dass meine Stimme singt, ohne jemals müde zu werden, dass ich immer weiter machen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen, ob die Kraft auch morgen noch reichen wird.
Nach dem Konzert Einladung bei Prof. Abdullin, der fürstlich aufgetafelt hat und extra für mich anstelle eines russischen Wodkas einen wunderbar weichen französischen Kognak in einer Kristallflasche in Form des Eifelturms aus dem Schrank holt. Und nun habe ich wieder einmal Gelegenheit, die Trinkfestigkeit meines Kollegen zu bewundern, der sonst auch bei festlichen Anlässen nie mehr als ein halbes Glas Wein trinkt. Am Ende des Abends werden die beiden Herren – ich bin da keine wirkliche Hilfe – den Inhalt des Wahrzeichens von Paris soweit dezimiert haben, dass man zu später Stunde guten Gewissens auseinander gehen kann, unter unzähligen Toasts auf die Musik, auf das Konzert, auf die Schönheit der anwesenden Dame und aller anderen dieser Welt, auf die Freundschaft und ganz besonders auf etwas, was mich richtig fröhlich macht, weil es gar nicht selbstverständlich ist in meinem Leben: auf unser Wiedersehen im September in Abchasien, wo wir alle drei beim selben Festival zu Gast sein werden.
Der schiefe Turm von Kazan und die größte Moschee Europas
Am nächsten Tag heißt es Abschied nehmen von Kazan, denn der Zug, der uns über den Ural bringen soll, startet um 14 Uhr am Ostbahnhof. Um 13 Uhr werden wir am Hotel abgeholt, also – Wecker stellen auf 9 (was sich für mich immer noch sehr hässlich nach 7 Uhr anfühlt) Koffer packen, Zimmer räumen, Kaffee trinken (wer weiß, wann es die nächste Mahlzeit geben wird) und dann wollen wir uns endlich den Kreml aus der Nähe ansehen.
Wir laufen los, auf gut Glück in die Richtung, in der wir bei der Ankunft vom Auto aus die große Mauer gesehen haben. Die Fußwege sind heute nicht weniger glatt als gestern, aber Aivars ist den Umgang mit vereisten Straßen von zu Hause gewöhnt und ich weiche immer wieder auf die Fahrbahn aus, sodass wir relativ gut voran kommen und bald die Treppe zum Eingang des Weltkulturerbes von Kazan hinaufsteigen. Keine Sicherheitskontrollen, keine Eintrittskarten wie am Kreml von Moskau, wir laufen ganz einfach durchs Portal vom Eingangsgebäude, dem Erlöserturm, dessen Form wie so vieles in diesem Teil der Erde an eines der antiken Weltwunder erinnert, an den Leuchtturm von Alexandria, der Opfer eines Erdbebens geworden ist, aber dessen architektonische Idee in unzähligen russischen Bauwerken fortlebt. Wir laufen hindurch und wir tun es gemeinsam mit all denen, die wir später auf dem Gelände in einem der Gotteshäuser bei der Andacht treffen werden oder im Restaurant bei der Mittagspause – dieser Kreml ist kein Museum, sondern er ist Teil der Stadt.
Und er ist ein Traum. Eine Sinfonie in Pastell, ein Gesamtkunstwerk des barocken Luxus und der Eleganz, erbaut von Iwan IV – besser bekannt als der Schreckliche – nach dessen Übernahme der Stadt, genau an der Stelle, wo vorher der Palast des Khan gestanden hatte, des Herrschers über das Gebiet, das sich heutzutage Tatarstan und Mari El teilen. Fassaden, so weiß wie der Schnee, schmiedeeiserne Tore und Laternen und über allem ein milchblauer Himmel, der die Konturen der Häuser weichzeichnet und den Gesichtern die Härte nimmt. Hellblaue Kuppeln auf den Türmen der orthodoxen Kirche und ebensolche gleich nebenan auf der neu erbauten Moschee, die man als größte Europas zum Zeichen des friedlichen Miteinanders beider Religionen auf das selbe Gelände gestellt hat und deren Farbe auf dem Dach – sei’s unbewusst, sei’s mit Bedacht – ein wenig Grün beigemischt wurde, dem Symbol des Paradieses und der Auferstehung im Islam.
Ganz am Ende der Hauptallee das Wahrzeichen der Stadt, der sogenannte schiefe Turm von Kazan, der seinen offiziellen Namen einer traurigen Legende um den Tod der letzten tartarischen Königin Sujumbike verdankt und der nicht nur deshalb das Kernstück des Platzes ist. Der Turm der Sujumbike nämlich ist das einzige Bauwerk innerhalb der Kremlmauern, das roten Backstein trägt, und damit ist er derjenige, der durch seine Andersartigkeit in diesem makellosen Ensemble der architektonischen Geschlossenheit einen Akzent der Asymmetrie setzt, etwas, das dem Ganzen den Charme des Lebendigen verleiht, gerade so, wie ein ganz kleiner Leberfleck im Gesicht einer schönen Frau.
Und hier, am Platz der Sujumbike, bekomme ich endlich die Antwort auf die Frage, wo sie alle wohnen, die unzähligen Menschen, die in Kazan zuhause sind. Der Platz liegt höher als die Mauer des Kreml und gibt den Blick frei hinweg über die Wolga, die an dieser Stelle die Breite eines riesigen Sees hat. Und da liegt sie in der Ferne, die Millionenstadt mit ihrem Häusermeer, soweit das Auge reicht. Links im Bild, hoch über den Dächern der Hochhäuser, ein einzelner Schornstein, der wie der Griffel eines Zeichners ein strahlend weißes Wölkchen in den Äther pudert, rechts die Silhouette eines Riesenrades – die beiden sind ein perfektes Paar, das auch diesem modernen Teil der Stadt einen märchenhaften Zauber verleiht.
Im rollenden Hochofen nach Jekaterinburg
Der Bahnhof von Kazan ist groß, fast so groß wie der Flugplatz einer Großstadt mit mehreren Etagen und unzähligen Möglichkeiten, sich zu verlaufen, und so ist es ein wahres Glück, dass Alexandra es sich nicht nehmen lässt, uns persönlich auf dem richtigen Bahnsteig abzuliefern.
Unser Zug ist unendlich lang und verströmt außen wie innen den Charme einer historischen Eisenbahn der Firma Märklin – Spur II. Vor jedem Wagon Schaffnerinnen, die sich zur Begrüßung der Gäste und zur Kontrolle der Reiseunterlagen ein folkloristisches Kleid nebst flachem Käppy übergeworfen haben, was ihnen das Aussehen von Matrjoschka – Püppchen verleiht, die man hintereinander aufgereiht hat. Wir stemmen unser Gepäck an Bord – Abschied von Alexandra, vielen, vielen Dank für alles, Marzipan und eine Brosche als Andenken, und dann wird sie immer kleiner auf dem großen Bahnsteig und ich frage mich, ob wir uns wohl jemals wieder sehen werden. Im Abteil treffen wir unsere Reisegefährten, die Tartarin Nella, die unterwegs ist in ein neues Glück auf der anderen Seite der großen Berge gemeinsam mit ihrem russischen Bräutigam, der in einer kleinen Stadt in der Nähe von Jekaterinburg wohnt. „Sorry Mam, my name is Jonny“, begrüßt er mich wie ein Cowboy, der soeben nach einem langen Ritt vom Pferd gestiegen ist, und fordert uns auf, Platz zu nehmen, um gemeinsam mit mit ihm und einer Wodkaflasche – außen Pushkins Portrait und innen eine kräftige Flüssigkeit, die er mit zwei Scheiben von der Zitrone veredelt hat – die Planung der nächsten Generation zu feiern.
Wir nehmen einen Schluck aus seinen mitgebrachten Pappbecher und machen uns daran, unser Gepäck unter der Sitzbank zu verstauen und die Decken und die Strohsäcke zum Unterlegen mit wunderbar gestärkten und gemangelten Bezügen zu versehen, die jeder eingeschweißt auf seiner Bank vorfindet. Ein Schaffner kommt mit einer Liste und fragt nach unseren Getränkewünschen und wir haben es in Erwartung von Tee, Kaffee und Kipitok allmählich richtig gemütlich in der Enge des Abteils, das Fahrgästen mit einer Körperhöhe von mehr als 1, 80 m allerdings weder aufrechtes Sitzen noch ausgestrecktes Liegen ermöglicht. Ich lasse eine Tafel Schokolade aus Deutschland herumgehen, Nella erzählt, wie sie als Kind an jedem Wochenende ein kleines Stückchen Konfekt geschenkt bekommen hat von ihrer Großmutter, die es als Arbeiterin in einer Süßwarenfabrik versteckt in der Frisur aus vom Werksgelände geschmuggelt hat. Und dann führt sie uns vor, wie es klingt, wenn man sich auf tartarisch viel Glück, viel Erfolg und viele Kinder wünscht und ich stelle fest, dass diese Sprache mit ihren Nasallauten und ihren engen Vokalen eine große Ähnlichkeit zum Türkischen hat – was Wunder.
Vor den Fenstern türmt sich der Schnee, innen ist es schön warm, beinahe ein bisschen zu schön, finden wir, und machen uns auf die Suche nach dem Regulator für die Heizung. Leider gibt es so etwas nicht auf dieser Strecke und auch die Fenster lassen sich nicht öffnen in diesem Eisenbahnmodell, sodass ich beschließe, die Löcher der Heizungsrohre, aus denen unterm Fenster der kochende Dampf entweicht, mit unseren Zudecken zu verschließen. Das hilft, aber leider nicht auf Dauer, irgendwann ist der eiserne Fuß, der das Abteiltischen hält, so heiß, dass man ihn nicht mehr mit der Hand berühren kann, ohne Blasen zu bekommen an den Fingern. Auch auf den Fluren herrschen dieselben tropischen Verhältnisse, nur im Vorraum zu den Toiletten ist es ungeheizt. Ich hole also einen Bindfaden aus meinem „Sondergepäck für den Katastrophenfall“ und frage die Mitreisenden in den Nachbarabteilen, ob sie etwas dagegenhaben, wenn ich die Schwingtüren zum Vorraum der Toilette mithilfe meines Fadens am Zufallen hindere.
Es ist ein Vorschlag, der mir zwar die ungeteilte Zustimmung aller meiner Leidensgenossen einbringt, es ist aber auch einer, der sich überhaupt nicht mit der Agenda des Schaffners in Einklang bringen lässt – und der hat leider das Hoheitsrecht in unserem rollenden Hochofen. Ich tröste mich also damit, dass die Tortur nicht länger dauern wird als 13 Stunden, denn der Fahrplan meldet die Ankunft um 5 Uhr in der Frühe – und werde eines besseren belehrt von Nella, die mir erklärt, dass in ganz Russland der Verkehr nach Moskauer Zeit funktioniert, dass ich also die beiden Stunden, die ich geglaubt hatte, durch den weiteren Zeitzonensprung abziehen zu können von der Fahrtzeit, wieder draufschlagen muss aufs Gesamtpaket.
Okay, es ist, wie es ist, da hilft nur eines: hinlegen, auf gar keinen Fall einschlafen, sondern ständig bewegen auf der kochenden Gummipritsche, damit man nicht ständig nassgeschwitzt aufwacht, und alle halbe Stunde ab in die eiskalte Toilette zum herunterpegeln der Körpertemperatur.
Es wird die anstrengendste Nacht unseres Lebens, zwei Stunden vor Ankunft in Jekaterinburg werden die Toiletten mitsamt der Waschbecken geschlossen, weil der Zug sich der riesigen Stadt nähert und Kaffee, Tee und Kipitok bleiben auf jeden Fall für uns Objekte der ewigen Vorfreude, die ja bekanntlich das schönste am Schönen ist.
Vom Wallfahrtsort der Romanoffs zum Meteoriten von Tscheliabinsk
In Jekaterinburg erwartet uns eine vollkommen andere Welt, alles ist deutlich größer, deutlich schneller, deutlich kälter und deutlich grauer als auf der anderen Seite des Ural. Unser Hotel, in dem wir ein Zimmer nur bis zum Abend haben, weil wir um 23 Uhr abgeholt werden nach Tscheliabinsk, wo am nächsten Tag unser letztes Konzert stattfinden soll, liegt direkt am Bahnhofsplatz, eine Bettenburg mit Sieben-Sterne-Standard, was uns als erstes ein wundervolles Frühstück mit frischem Obst und frischem Saft und frischen Delikatessen aller Art beschert. Das Leben ist wieder schön, auch ohne Schlaf, und ich freue mich auf das Singen und darauf, dass wir für heute ein ganz anderes Programm mit Klavier abliefern sollen, weil die Orgel im neuen Konzertsaal nicht fertig geworden ist. Das bedeutet nicht nur eine willkommene Abwechslung für uns, sondern auch fast keine Probenzeit, alles ist so schnell gemacht, dass wir es sogar schaffen, noch einen Blick auf die Stadt zu werfen.
Unweit vom Hotel wurde 1918 der Zar mit Gattin und Kindern ermordet – heute steht an derselben Stelle eine orthodoxe Kirche, die „Kathedrale auf dem Blut“, erbaut zu Ehren der Zarenfamilie, deren Mitglieder inzwischen als Märtyrer heilig gesprochen worden sind. Die wollen wir uns anschauen, dafür reicht die knappe Zeit. Tapfer laufen wir los, es ist hier noch viel kälter als gestern in Kazan und ich habe als Ersatz für Mütze und Schal meine Kuscheldecke um den Kopf gewickelt. Den großen vierspurigen Prospekt entlang, rechts und links, genauso wie in Moskau, die Fassaden der Edel-Einkaufsmeilen, auf deren blicksicheren Scheiben man bewundern kann, was dahinter verkauft wird, in der Mitte bunt und eilig der Verkehr, modernste Autos und LKWs, dazwischen Straßenbahnen und gelegentlich auch Laster, die aussehen wie Exponate aus dem Spielzeugmuseum, der Tüv ist hier offensichtlich nachsichtiger als bei uns. Man kommt gut voran in dieser geschäftigen Stadt, überall sieht man Arbeiter mit Hacke und Eimer, die versuchen, immer größere Schneisen in das Eis auf den Gehwegen zu schlagen.
Ich halte Ausschau nach einem Supermarkt, um ein paar Mitbringsel zu kaufen, aber ich sehe nichts als Pelzgeschäfte in Serie, eine Konditorei, eine Parfümerie, und schon sind wir am Platz der Kathedrale. Von der Straßenseite aus ist die Tür verschlossen, aber der Andenkenladen hat geöffnet, hier gibt es Devotionalien aller Art und Postkarten von der Zarenfamilie und von sämtlichen neu gebauten Kirchen in der Stadt. Aivars findet ein Gesangbuch, ich nehme einen Anhänger aus Malachit, einem grünen Halbedelstein aus dem Ural, und dann zeigt uns die nette Dame hinter dem Tresen den Eingang zur Kathedrale, in der gerade Gottesdienst gefeiert wird. Aivars nimmt die Mütze ab, ich ziehe meine Decke über den Kopf, und dann reihen wir uns ein in den langen Zug der Gläubigen, denn wir sollen die Lieblings-Ikone der Zarin anschauen, eine rotgewandete Mutter Gottes von bezaubernder Schönheit. Ein unsichtbarer Chor singt, während sich die Gläubigen segnen lassen, es sind viele dabei, die extra angereist sind, die Kathedrale ist ganz offensichtlich ein Wallfahrtsort von großer Bedeutung. Wir müssen Abschied nehmen, zurück ins Hotel, schnell an die Arbeit, und dann steht auch schon der Wagen von der Oper in Tscheliabinsk vor der Tür, um uns 200 km weit durch die Nacht zu tragen.
200 km, das klingt näher als es ist, wenn man auf Straßen fährt, die von unzähligen Schwertransporten so stark belastet sind, dass man auf ihnen zum Teil nicht schneller als 45 km/h punktgenau fahren darf und dabei dennoch so fröhlich durchgeschüttelt wird, als würde man Hoppe-Reiter auf den Knien seines großen Bruders machen, weil nämlich der Wagen, den man für uns reserviert hat, von der Sorte ist, in dem man mühelos ein halbes Kammerorchester nebst Zubehör verstauen kann. Am Stadtrand von Tscheliabinsk zeigt uns Igor, der diesmal dafür sorgen soll, dass wir wohlbehalten ans Ziel kommen, wo im Jahr 2013 der Meteorit auf die Stadt niedergegangen ist und auch das Museum – ganz in der Nähe unseres Konzerthauses – in dem seine Einzelteile ausgestellt sind.
Und am nächsten Tag wird uns ein Kollege erzählen, warum der Einschlag nicht nur eine entsetzliche Panik, sondern auch eine kopflose Massenflucht ausgelöst hat. Unweit der Stadt gibt es eine Kerntechnische Anlage, in der im Jahre 1957 bereits einmal ein Tank explodiert ist, weil die Kühlung ausgefallen war, so dass nun, beim Einschlag des Meteroiten, als morgens früh der Himmel brannte und die Fensterscheiben borsten, jedermann in Tscheliabinsk geglaubt hat, es habe wieder einmal einen Supergau im Kernkraftwerk gegeben. Das alles muss furchtbar gewesen sein für die Stadt und ihre Bewohner. Aber spät am Abend nach dem Konzert werde ich erfahren, dass es auch hier, wie bei fast jeder Katastrophe, einen Gewinner gibt: eine Konzertbesucherin überreicht mir eine große, silberne Kiste mit Pralinen von einer alteingesessenen ortsansässigen Schokoladen-Manufaktur. Die „Himmlischen“ werden die braunen Brocken weltweit genannt, doch in Tscheliabinsk steht seit eh und je „Meteorit“ in magmafarbenen Lettern auf der Schachtel, ohne dass das allerdings den Verkauf des Traditionsartikels jemals besonders positiv beeinflusst hätte. Nun aber, nach dem bösen Besuch des echten Zwillings aus dem All, hat sich der Absatz der Zucker-Kugeln – sehr zur Freude der Geschäftsleitung – sprunghaft vervielfacht und man muss nicht einmal mehr Werbung machen für das Produkt.
Aber von all dem weiß ich noch nichts, als wir in dieser Nacht zu so derart später Stunde einchecken ins Hotel, dass ich beschließe, sowohl das Frühstück als auch das Auto, das uns am nächsten Morgen zum Konzertsaal und zur Probe bringen soll, fahren zu lassen – denn zehn Uhr, das hat für meine mitteleuropäischen Ohren, auf die ich mich seit nunmehr 40 Stunden nicht mehr gelegt habe, doch irgendwie einen sehr unguten Beiklang von 6 Uhr in der Frühe.
Aivars ist sofort einverstanden damit, dass ich ihn morgen mal allein üben lasse, und ich sehe kein Problem darin, die wenigen hundert Meter, die mich vom Konzertsaal trennen, zu Fuß zurückzulegen. Wir verabreden, dass ich ihn bei Ende der Probenzeit um 1 Uhr Ortszeit abhole zu einem kleinen Imbiss mit anschließendem Kurzbesuch beim Meteoriten im Museum, bevor wir uns dann im Hotel umziehen wollen und zur Anspielprobe in den Saal gebracht werden.
Schwarzer Schnee und ein Kunstmarkt bei Minus 25 Grad
Das alles klingt nach solider Planung und als ich um 12 Uhr 15 das Hotel verlasse – zwar immer noch zerschlagen an Kopf und Gliedern, aber doch voller Vorfreude auf die funkelnagelneue Orgel von Tscheliabinsk – tue ich es in dem Gefühl, so gut in der Zeit zu sein, dass ich meinen fleißigen Vorarbeiter damit überraschen kann, dass die Zeit bis zum Ende der Probe noch für einen schnellen Durchlauf seiner Choralsonate reichen wird. Der Himmel ist genauso milchblau wie der in Kazan, als ich das Hotel verlasse und hinausgehe in den strahlenden Tag, auf die vierspurige Ausfallstraße, rechts hinunter in Richtung Opernhaus und Brücke. Aber alles, was am Boden liegt, das sieht genauso aus wie all das, was ich auch an unserem Winter nicht mag, wenn er zu lange dauert. Der Schnee ist ebenso schmutzig wie bei uns, wenn er länger als vier Wochen liegt, und an den Straßenrändern, da ist er schwarz – Tscheliabinsk ist eine der größten Industriestädte in ganz Russland, und das hinterlässt eben nun einmal seine Spuren in der Atmosphäre.
Leider hat die Farbe des Eisbelags auf dem Gehweg keinerlei Einfluss auf die Disposition der Oberfläche bei Reibung durch darüberlaufende Füße – das Eis ist in grau genauso teuflisch glatt wie in weiß, und plötzlich erscheint mir der Weg bis zum Konzertsaal gar nicht mehr so kurz wie gestern abend durchs Fenster unseres fröhlichen hüpfenden Busses und die Zeit bis zum Ende der Proben gar nicht mehr so üppig, wie ich es gern hätte. Aber man weiß sich ja zu helfen, die Kraft liegt im Kopf, sage ich mir, auch wenn der arme eigentlich noch gar nicht richtig im Dienst ist heute morgen, und so beschließe ich, mich an den eisernen Geländern entlang zu hangeln, die hier überall die Fußwege von der Fahrbahn trennen, eine richtig gute Idee, finde ich, und freue mich darüber, dass ich nicht vergessen habe, meine Handschuhe mitzunehmen.
Es klappt vorzüglich und schon bald bin ich am Opernhaus mit seinen vielen Säulen und muss nun nur noch links über den Fluss, die Miass, über eine schöne alte steinerne Brücke, denn gleich dahinter sehe ich auf der anderen Seite des Ufers schon den Platz mit unserem Konzerthaus. Alles gar nicht weit. Alles gut zu schaffen. Alles kein Problem. Aber der Fluss ist breit, besonders bei diesen Straßenverhältnissen ist er sehr breit, und der Fußweg, der hat hier kein Geländer, an dem man sich festhalten könnte. Stattdessen pfeift mir der Winter grausam und frontal ins Gesicht, sobald ich den Windschatten der Häuser verlasse, er kommt genauso überraschend wie in Kazan auf dem Flugplatz und er tut mindestens genauso weh.
Es ist wie ein Reflex. Ohne zu bedenken, dass ich natürlich seit Monaten die einzige bin, die an dieser Stelle der Stadt die Geländer poliert, halte ich mir schützend die Hände vor das schmerzende Gesicht, stolpere vom Fußweg auf die provisorisch geräumte Fahrbahn, die gottlob heute am Sonntag nur wenig von denen genutzt wird, für die sie eigentlich reserviert ist, und rutsche mit gesenktem Kopf Richtung Ufer, ohne zu ahnen, dass der ganze Dreck der aktuellen Wintersaison inzwischen von den Innenflächen meiner Handschuhe auf mein Gesicht übergesprungen ist und mir das Aussehen eines Schornsteinfegers gibt.
Auf dem Parkplatz vor dem Konzertsaal stehen in langer Reihe parkende Autos, an jedem lehnt ein Mann und wartet. Man könnte sie für Taxis halten, wenn da nicht auf der anderen Seite der Fahrbahn in ebenso langer Reihe unzählige farbenfrohe Gemälde in den Schnee gestellt worden wären. Ein Kunstmarkt, bei 25 Grad minus auf einem total menschenleeren Gelände vor einem Haus, in dem ein einsamer Akkordarbeiter auf mich und seine Mittagspause wartet, das alles macht keinen rechten Sinn.
Vogelstimmen im eiskalten Asien
Es ist inzwischen zehn vor eins, eilig laufe ich die wenigen breiten Stufen hinauf zwischen den ionischen Säulen, die auch an diesem Gebäude die Verbundenheit Russlands mit der griechischen Kultur dokumentieren, und will hinein ins Haus durch die weit geöffnete Eingangstür. Zwei Damen verstellen mir den Weg. Missbilligend schauen Sie mir ins Gesicht – offenbar weiß man hier nicht, dass ein Schornsteinfeger ein Glücksbringer ist – und verlangen etwas, was ich mit Eintrittskarte übersetze. Nix Billet, eta Martina, eta piviäts, ich soll arbeiten, rabota, keine Zeit. Die Damen bleiben unbeeindruckt von meinem Fleiß und unerbittlich in ihrer Position. Es geht auf eins und ich werde allmählich nervös. Wer weiß, vielleicht verlässt Aivars gerade durch einen der anderen Ausgänge das Haus, während ich Eintrittskarten kaufe, die ich nicht haben will, und fährt oder läuft Richtung Hotel, weil er glaubt, ich sei nicht gekommen, ich kann ihn nicht erreichen, sein Handy hat er wegen der unkalkulierbaren Kosten in Lettland gelassen und die Vorstellung, mich auf Verdacht zurück zum Hotel durchzukämpfen, ist mir unerträglich.
Und da tue ich etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte, etwas, das sich weder mit meiner Erziehung vereinbaren lässt noch mit meiner Vorstellung davon, wie man miteinander umgehen soll in diesem Leben. Ich schiebe die beiden Tempelwärterinnen einfach zur Seite und stürme die Treppe hinauf, hinein in den Saal, in dem Aivars an der Tür steht und auf mich wartet, zu meinem maßlosen Erstaunen inmitten von anderen erwartungsvollen Leuten, die mit Kind und Kegel gekommen sind, um den neu gebauten Kulturpalast von Tscheliabinsk von innen zu bewundern und zu erleben, wie die darin stationierte Königin der Instrumente klingt – was in Russland mit seinen orgellosen orthodoxen Kirchen ein viel spannenderes Ereignis ist als bei uns.
Vladimir Khomiakov, ein ortsansässiger Organist spielt Bach, die Kinder schlafen auf dem Schoß ihrer Eltern in der wohligen Atmosphäre des hellblau-weißen Stuckatur-Ensembles mit seinen Säulenreliefs und Rundbögen, die Erwachsenen lauschen beeindruckt, wir bleiben natürlich, hören zu und gehen anschließend mit dem Kollegen essen und Tee trinken mit seiner Frau – auch sie ist eine von denen, die sich zu nichts überreden lassen bei Tisch – ins gegenübergelegene Restaurant. Vorher hat Aivars vergeblich versucht, mich mit Hilfe seines karierten Großvatertaschentuchs vom Schmutz der Straße zu befreien, aber der Dreck ist farbecht auf meinem Gesicht und verteilt sich zu großen grauen Flecken, die mir das Aussehen einer Lebendvorlage zu Edward Munchs Schrei verleihen.
Wir lassen Museum und Meteoriten ausfallen, die Zeit ist knapp inzwischen, es bleibt eine Viertelstunde zum Umziehen im Hotel, das Gesicht muss bleiben, wie es ist, kurze Anspielprobe, ein Schluck Wasser in der Garderobe, Begrüßung einer gestrengen Dame mit aristokratischem Profil, die unser Konzert moderieren wird und an deren beeindruckender schwarzer Robe mit großem Ausschnitt, um das sie eine blütenweiße Federboa drapiert, ich sehen kann, wie hochkarätig heute abend hier der neue Musentempel von Tscheliabinsk gefeiert wird.
Der Saal ist wie immer ausverkauft, das Publikum wie immer vom ersten Ton an fröhlich bei der Sache und ich bin wie immer unendlich dankbar für die unglaubliche Duldsamkeit meiner Stimme, die sich auch heute nichts anmerken lässt von den Strapazen, denen ich sie in den letzten Tagen ausgesetzt habe.
Alles ist auch hier wie immer und doch ist auch hier wie immer alles ein wenig anders auf dieser Reise zwischen den Welten. Beim Singen meiner Lieblings-Vogelstimmen-Imitation, die mir jedes Mal einen Riesenspaß macht in der gemeinsamen Vorfreude mit dem Publikum auf den Frühling, der ja bei uns, wo die Vögel beim ersten wärmeren Sonnenstrahl anfangen zu singen, irgendwie immer in der Luft liegt, beschleicht mich plötzlich ein merkwürdiges Gefühl für die eigene Exotik, während ich mit der Orgel um die Wette zwitschere wie die Drosseln in meinem Garten. Eine Frage, die mir nie gekommen ist, nicht im äußersten Süden und auch nicht im äußersten Norden unseres Kontinents, beschleicht mich hier im eiskalten Asien plötzlich parallel zur Konzentration auf das, was ich gerade tue: Wie viele der Menschen, die dort vor mir im Saal sitzen und sich mit mir freuen, haben eigentlich jemals bei einem Spaziergang durch die Natur die Vögel singen gehört?
Und während ich weitermache und mein Blick durch den Raum gleitet, der auf märchenhafte Weise die Formen einer römischen Villa mit Meeresblick und die Farben eines Sommerhimmels mit Cirruswolken in sich vereint, fange ich an, noch etwas zu verstehen: hier, wo der Winter sechs Monate lang bleibt und der Sommer sich nach drei Wochen verabschiedet, um für den Rest des Jahres einer grauen Schmuddelwetterperiode Platz zu machen, hier malt man sich – wunderbar konsequent – den Traum vom mediterranen dolce fa niente eben einfach an die Wand, ohne sich darum zu kümmern, was der Rest der Welt vielleicht dazu sagen mag.
Diesen Reisebericht, der hier nun auf vielfachen Wunsch in voller Länge zu lesen ist, habe ich im Auftrag der Tageszeitung „Stormarner Tageblatt“ als Vorlage für folgenden Artikel geschrieben:
http://www.shz.de/lokales/stormarner-tageblatt/eine-abenteuerliche-konzertreise-zu-den-musikalischen-tataren-in-westsibirien-id9461746.html
Mein besonderer Dank geht an die Redakteurin Susanne Rohde-Posern, die mir beim Schreiben meines Textes keinerlei Einschränkungen auferlegt hat, sondern das Ganze anschließend wunderbar klug und einfühlsam auf die Länge einer Zeitungsseite zugeschnitten hat, und an unsere Kollegin Ludmilla Kamelina für die perfekte Organisation der Reise, ebenso wie an Arseniy Ushkov für die Bilder Nr. 5, 6 und 7 (Staatsoper Joshkar Ola) und an Vladimir Khomiakov für die Bilder Nr. 16, 17 und 18 (Konzertsaal Tscheliabinsk).
Aivars Kalejs hat die Fotos von der Moschee in Kazan und von der Kathedrale in Jekaterinburg gemacht und alle anderen sind von mir selbst, die ich hiermit auch unseren liebenswürdigen Reisegefährten im Zug nach Jekaterinburg ganz herzlich danke für ihre Erlaubnis, sie zur Bebilderung meines Reiseberichts zu fotografieren.